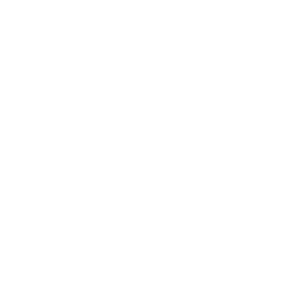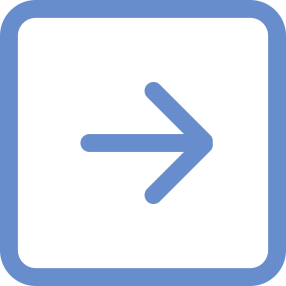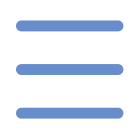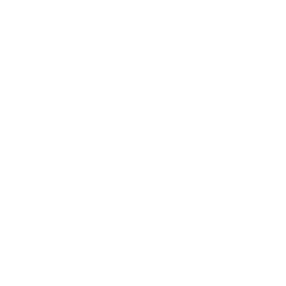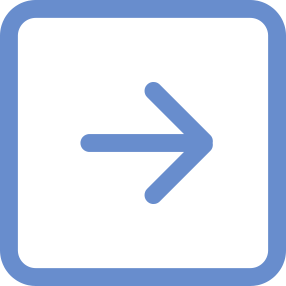Handels- und Gesellschaftsrecht
Ihre Anwälte

Partner, Rechtsanwalt
Hamburg

Geschäftsführender Partner, Rechtsanwalt
Hamburg

Geschäftsführender Partner, Rechtsanwalt
Hamburg

Partner, Rechtsanwalt
Hamburg

Partner, Rechtsanwalt
Stuttgart

Partner, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer
Hamburg

Rechtsanwalt
Hamburg

Rechtsanwalt
Stuttgart
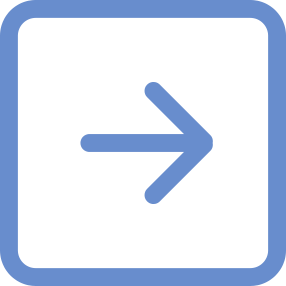
In diesem Artikel verdeutlicht Partner RA Dr. F. Müller die nicht dem Steuersystem entsprechenden Regelungen bei den Einkünften aus Kapitalvermögen und gibt dazu vorläufige Einschätzungen.
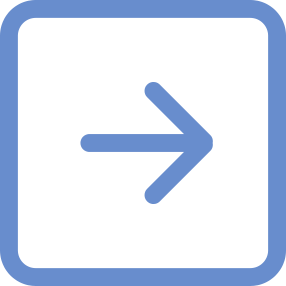
Im aktuellen Blog von unserem Partner Dr. Ferdinand Müller aus Stuttgart erfahren Sie mehr über das neue Personengesellschaftsrecht, das ab 01.01.2024 gilt.
Das neue Personengesellschaftsrecht – der ganz große Wurf?
Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrecht (MoPeG=Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz) wird das Recht der Gesellschaft bürgerlichen Rechts erstmals seit über 100 Jahren einer größeren Reform unterzogen. Inkrafttreten wird das Gesetz allerdings erst am 1.1.2024. Grund für die Reform war unter anderem auch die recht späte Anerkennung der Rechtsfähigkeit der Außen-GbR (BGH II ZR 331/00) und die Anerkennung der Grundbuchfähigkeit der GbR im Jahre 2009 (BGH, AZ: V ZB 74/08, BGHZ 179,102), die das Gesetz vor 100 Jahren so noch nicht in die Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch integriert bzw. voll bedacht hatte. Andererseits wurde immer ein „Publizitätsdefizit“ bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts von manchen Stimmen zu Recht oder zu Unrecht bemängelt. Durch die Reform soll die Gesellschaft bürgerlichen Rechts zur Grundform rechtsfähiger Personengesellschaften werden, sie rückt aber auch näher an die Personenhandelsgesellschaften.
Nun wird ausdrücklich im Gesetz zwischen rechtsfähiger und nicht rechtsfähiger GbR unterschieden. Auf das Gesamthandsprinzip (so noch bestehend bei der Erbengemeinschaft) soll künftig als grundlegende Änderung verzichtet werden. Weitere wesentlicher Änderungsaspekt aus der Sicht der Praxis ist die nunmehrige Haftung der Gesellschafter unbeschränkt - direkt aus dem Gesetz.
Einer entsprechenden Anwendung von Regelungen aus dem HGB braucht es dann nicht mehr.
Durch das neue Gesellschaftsregister für die BGB-Gesellschaft besteht diesbezüglich ein Eintragungswahlrecht in Kombination mit Anreizen und teils einem mittelbaren Zwang zur Registrierung. Ein faktischer Zwang zur Eintragung besteht nun künftig dann, wenn eine GbR eingetragene Rechte erwerben will.
Außerdem wird von einer eingetragenen Gesellschaft im Rechtsverkehr mehr Vertrauen entgegengebracht und auch Finanzinstitute werden eine eingetragene Gesellschaft besser bewerten im „Score“ als eine nicht eingetragene Gesellschaft.
Sollten sich bestehende Gesellschaften deshalb eintragen lassen?
Bedacht werden muss dabei, dass durch die Eintragung Bindungswirkung eintritt und die BGB-Gesellschaft nur noch nach den allgemeinen Vorschriften gelöscht werden kann. Außerdem wird die GbR durch die Registereintragung zur rechtsfähigen GbR, die im Rechtsverkehr dann als solche auftritt. Folge aus der Registereintragung ist auch die Einbindung ins Transparenzregister. Dort gab es unlängst Gesetzesänderungen, weil das Transparenzregister das neue Vollregister werden soll.
Transparenzregister das neue Vollregister werden soll.
Eine juristische Person des Privatrechts oder eine eingetragene Personengesellschaft, die nach Absatz 1 Satz 1 mitteilungspflichtig ist und die nicht im Handelsregister, Genossenschaftsregister, Partnerschaftsregister oder Vereinsregister eingetragen ist, hat der registerführenden Stelle unverzüglich mitzuteilen, wenn
- sich ihre Bezeichnung oder ihr Sitz geändert hat,
- sie verschmolzen worden ist,
- sie aufgelöst worden ist oder
- ihre Rechtsform geändert wurde.
Folglich gilt die Bestimmung nach § 20 II GwG nicht für (derzeit)nicht eingetragene BGB-Gesellschaften.
Eine Registereintragung verpflichtet die BGB-Gesellschaft dazu, Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten einzuholen und entsprechend zu übermitteln (§ 20 I GwG). Verstöße gegen die Eintragungspflicht in das Transparenzregister sind bekanntlich bußgeldbewehrt. Jedenfalls wird die registrierte GbR in den Kreis der unmittelbar mitteilungspflichtigen Rechtsträger aufgenommen.
Wichtig für die Praxis ist zudem auch die zukünftige Regel im neuen § 720 BGB, der im (ungeachtet der Regelung des § 179 BGB) nicht unwichtigen GbR-Stellvertretungsrecht die Gesamt -Vertretungsbefugnis der GbR-Gesellschafter vorsieht.
Ein Registerauszug über eine Einzelvertretungsbefugnis eines Gesellschafters der BGB -Gesellschaft kann wiederum nur durch die eingetragene GbR vorgezeigt werden. Ergibt sich so allenfalls ein Motiv für eine künftige Eintragung.
Das Beschluss- Mängelrecht wir durch neues Gesetz auch geändert, nach dem Vorbild der Aktiengesellschaft angepasst, wonach es „anfechtbare Beschlüsse“ und „nichtige Beschlüsse“ gibt, wobei nur bestimmte gravierende Mängel zur Nichtigkeit des Beschlusses in diesem Bereich führen.
Zuvor hatte man eine Feststellungsklage (§ 256 ZPO) jahrzehntelang im Hinblick auf Beschlüsse der Gesellschafterversammlung als den Regelfall gehabt. Man konnte dabei die Rechtsfolge der Nichtigkeit durch Feststellungsklage richterlich feststellen lassen.
Oft gab es keine Befristungen diesbezüglich und es wurde auch nicht nach der Schwere eines Beschluss- Mangels tiefergehend differenziert. Ferner mussten kompliziert alle Gesellschafter in die forensische Auseinandersetzung einbezogen werden. Bei großen Gesellschafterkreisen war dies nicht einfach bzw. eine große Herausforderung, wegen allfälliger Adressen und Umzüge.
Nunmehr sind auch Klagen gegen die Gesellschaft von Gesetzes wegen möglich. Man muss allerdings dazu optieren. Bestehende Gesellschaftsverträge von GbR´s oder Partnerschaftsgesellschaften sollten durchaus darauf geprüft werden, ob die Anwendung des neuen Beschluss- Mängelrechts gewünscht oder gerade weiterhin vermieden werden soll. Regelungen in Satzungen von BGB -Gesellschaften, die gar eine Analogie zum GmbH-Recht betreffs der Beschlussmängel hergestellt haben, sollten auf jeden Fall zur Vermeidung von Missverständnissen neu formuliert werden.
Ob das MoPeG nun der „ganz große Wurf“ ist, wird sich noch zeigen. Auffällig ist auf den ersten Blick die größere Transparenz, die hier eintreten soll und der für Gesellschafter weniger wichtige Schutz des Rechtsverkehrs, also der Schutz von Dritten. Sicherlich wird in der einen oder anderen Hinsicht Handlungsbedarf bestehen. Anpassungen von GwG und BGB und Registerregelungen werden möglicherweise noch erfolgen. Richtig abschätzen lassen sich die Auswirkungen des MopeG noch nicht, auch nicht für den wirtschaftlich so bedeutenden Immobilienrechtsverkehr, da der Gesetzgeber sich in manchen Punkten entschieden hat, manches offen zu lassen und entsprechende Unklarheiten durch die Rechtsprechung über die Praxis klären zu lassen. Auch lässt sich noch nicht abschließend bewerten, was man reinen Ehegatteninnengesellschaften, die jedoch mit der Einkunftserzielung beispielsweise Vermietung und Verpachtung nach außen auftreten, punkto der diversen Neuerungen anraten soll.
Allerdings ist die Übergangsphase bis zum 1.1.2024 noch recht lang und die bestehenden Gesellschaften können sich auf jeden Fall entsprechend darauf einstellen und gewisse Punkte in ihrer Satzung anpassen. Der Vorrang der Satzung vor gesetzlichen Regelungen ist jetzt noch deutlicher hervorgehoben als zuvor, was die Privatautonomie im Personen-Gesellschaftsrecht stärkt.
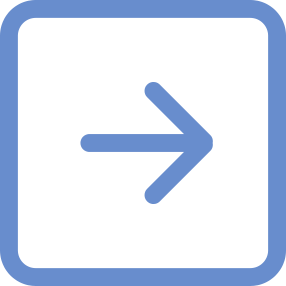
Im aktuellen NWB Experten Blog von unserem Partner Dr. Ferdinand Müller aus Stuttgart erfahren Sie mehr über die Änderungen durch das neue GeschGehG und seine Anwendung.
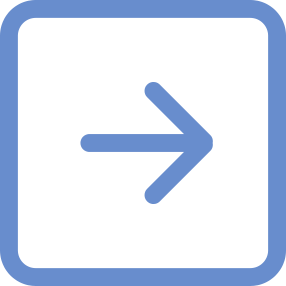
Mit dem JStG 2020 hat sich der Gesetzgeber veranlasst gesehen, die Frist für die Strafverfolgungsverjährung zu verlängern. Die Auswirkungen hieraus auf Aufbewahrungspflichten im Steuer- und Handelsrecht erläutert Partner Dr. Ferdinand Müller im NWB Experten-Blog.
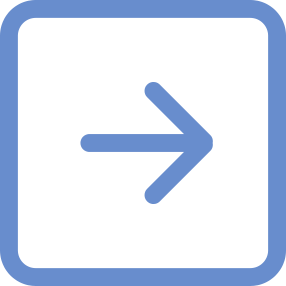
Die Bundesregierung hat Anfang Februar 2021 einen Gesetzesentwurf zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechtes auf den Weg gebracht. Schon der Referentenentwurf zum Gesetzentwurf überzeugt nicht, was Partner RA Dr. Müller in seinem Beitrag kurz skizziert.
Manchen kritischen Stimmen war der gesunde Wettbewerb zwischen den Bundesländern bei den Stiftungsgesetzen nicht mehr recht. Andererseits wurden Rufe nach umfänglicher Transparenz lauter, so dass ein zentrales Stiftungsregister verlangt wurde, neben dem schon lange implementierten Transparenzregister und den landesrechtlichen Stiftungsregistern, die es schon gibt. Alles ist natürlich mit enormen und irrsinnigen Kosten verbunden (was der dt. Gesetzgeber ja vor Erlass eines jeden Gesetzes zu prüfen hat!). Schließlich hatte der Gesetzgeber im Jahr 2014 eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Reform des Stiftungsrechts eingesetzt. Herausgekommen war im Jahr 2016 ein erster „Bericht“ und im Jahr 2018 ein Diskussionsentwurf. Auf dieser Grundlage erging dann durch das BMJV am 20.09.2020 gar ein Referentenentwurf. Dieser wird von der Professorenschaft, die sich mit Stiftungsrecht befasst, aus verschiedenen Gründen überwiegend abgelehnt.
Kritik am Inhalt des Entwurfs
Dieser jetzige Entwurf muss ich jedoch fragen lassen, was er eigentlich bewirken will. Ein Anliegen war z.B., notleidende Stiftungen mit geringen Einnahmen schon vor der endgültigen Unmöglichkeit der Zweckverfolgung, also bevor die Stiftung keinerlei Einnahmen mehr hat, durch Zweckänderung oder Umwandlung in eine Verbrauchstiftung anderweitig fortzuführen, was im Entwurf überhaupt nicht enthalten ist.
Ferner soll im BGB, wo aus historischen Gründen (Stiftungen übernehmen staatliche Aufgaben) des historischen Gesetzgebers allein die Gründung und Anerkennung mit Rechtsfähigkeitserlangung (vgl. Mugdan I 420, 961 ff.) geregelt wird, plötzlich steuerrechtliche Regelungen beinhalten, die systematisch und thematisch in der Abgabenordnung allenfalls hingehören. Warum es eine Vereinheitlichung sein soll, wenn Steuerrecht urplötzlich im Zivilrecht (BGB) auftaucht, entzieht sich jedem logischen Denken.
Darüber hinaus war im Organ-Haftungsbereich angedacht, wie bei anderen Gesellschaften ebenfalls üblich, eine Art business judgement rule (vgl. Art. 93 AktG analog) im Stiftungsrecht einzuführen, was gerade nicht vom Gesetzgeber aufgegriffen wurde.
Begriffe wie „Grundstock-Vermögen, sonstiges Vermögen, gewidmetes Vermögen sowie erworbenes und bestimmtes Vermögen“ sind auch eher dem Steuerrecht (AO) zuzuordnen, allenfalls noch den Landesgesetzgebern, was das Stiftungsgesetz der Länder anbetrifft.
Zudem hatte sich bewährt, dass es „ein Stiftungsgesetz“ nicht gibt, weil ja gerade die Landes-Finanzämter darüber entscheiden sollen, ob eine Stiftung als rechtsfähig anerkannt wird oder nicht und ob die Gemeinnützigkeit zu bejahen ist (Genehmigungsverfahren/Satzungsüberprüfung nach Landesrecht). Viele tatsächliche Förderungen der NPO´s finden auch in den 16 Bundesländern statt, sodass die Landesgesetzgebung im Stiftungsrecht durchaus ihre Berechtigung hat.
Es stimmt überhaupt nicht mit der Verfassung (GG)überein, wenn behauptet wird, die derzeitigen Landes- Stiftungsgesetze würden gegen „die Verfassung verstoßen“. Vielmehr ist richtig, dass allein der Referentenentwurf gegen die Verfassung und die Länderverfassungen verstößt, weil die Wahrnehmung von hoheitlichen Aufgaben ja gerade von einem bestimmten Bundesland heraus wahrgenommen wird. Warum eine Normierung von Vermögens- „Umschichtungen“ im Bürgerlichen Gesetzbuch plötzlich auftaucht, entbehrt jeglicher Grundlage.
„Mutmaßlicher Stifterwille“
Gegipfelt wird das nur noch davon, dass nicht wie bisher, bei Auslegungsfragen auf den „mutmaßlichen Stifterwillen“ abgestellt wurde, wenn sich bei einer notwendigen Satzungsänderung beispielsweise der tatsächliche Stifter/Stifterinnen-Wille nach langer Zeit nicht mehr ermitteln lässt (auch nicht aus für den mutmaßlichen Stifterwillen ebenso im Einzelfall maßgebenden erbrechtlichen Verfügungen), soll es nun allein nach diesem Referentenentwurf auf den „historischen Stifterwillen“ ankommen.
Diese Regelung ist mehr als verunglückt. Wenn der Stifterwille entgegen Art. 14 GG völlig ausgehebelt wird, wird es in Zukunft schwierig sein, Unternehmer von der Gründung einer Stiftung zu überzeugen. Diese Stiftungsgründungen wird es dann aller Voraussicht nach zukünftig nicht mehr geben und es ist sicherlich nicht gut für den gemeinnützigen Sektor (NPO), wenn nur auf den Bestand der bisherigen Stiftungen abgestellt wird.
Die Zulegung und Zusammenlegung hätte man auch in einem anderen Gesetz (neuer Abschnitt im Umwandlungsrecht, o.Ä.) regeln können als in umfangreichen Paragraphen im Bürgerlichen Gesetzbuch.
Stiftungsregister mit Publizitätswirkung
Das lange geforderte Stiftungsregister mit Publizitätswirkung ist im Entwurf zwar vorgesehen. Die Befassung des Bundesamtes für Justiz mit der Führung des Registers ist ebenfalls verfassungsrechtlich höchst bedenklich und eine Durchbrechung des föderalen Systems des Verwaltungsvollzugs durch die Länder (auch bei Bundesgesetzen) und ist insgesamt nur mit Kosten verbunden.
Naheliegend wäre doch gewesen, allenfalls bei den Vereinsregistern bei den Amtsgerichten in den Ländern die Sache zur verorten, dort zu verwalten und die Sache nicht unnötig zu zentralisieren.
Privat- und Stifterautonomie
Insgesamt wird mit dem Referentenentwurf die Privat- und Stifterautonomie von Stifterinnen und Stifter massiv beschnitten. Keine bis heute gegründete Stiftung konnte mit Derartigem rechnen, weshalb auch Anwendungsvorschriften im Referentenentwurf fehlen. Ein Prinzip der „Satzungs-Strenge“ soll angeblich eingeführt werden, welches es bisher nur bei der Aktiengesellschaft wegen ihrer Börsengängigkeit und dem Schutz von Aktionären gibt und welches überhaupt nicht auf die BGB-Stiftungen, die gerade keine Mitglieder haben, irgendwie passt.
Verständlichkeit des Stiftungsrechts
Dass nun das derzeitige Stiftungsrecht nicht (ebenso wie das gesamte Steuerrecht!) für jeden nicht gleich verständlich ist, ist nicht im Grunde ein Rechtsstaats-Problem. Die steuerrechtlichen Rahmenbedingungen waren immer schon in der Abgabenordnung und im Anwendungserlass zur Abgabenordnung geregelt, wo sie systematisch hingehören. Die Verfasser des Bürgerlichen Gesetzbuchs haben die Stiftung allein wegen ihrer Gründung und Anerkennung und wegen ihrer damaligen Bedeutung für die Wohlfahrtspflege als öffentliche Aufgabe in den Allgemeinen Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches aufgenommen. Im Grunde wäre allenfalls an ein reines Stiftungsgesetz zu denken, wobei dies ja auch wieder momentan mit den Ländergesetzen nicht zu vereinbaren wäre, die, was Sinn macht, hauptsächlich Stiftungsaufsichtsgesetze sind.
Im Übrigen kam es in der Stiftungspraxis schon immer auf die Satzung an und den Stifterwillen, und wegen dem hohen Gut der Stiftungsautonomie (Art. 2 Grundgesetz und Art. 14 GG) sollten Stifter auf keinen Fall entmachtet werden. Auch sollten Stiftungen weiterhin vom Gesetzgeber wohlwollend behandelt werden. Schließlich hat der gemeinnützige Sektor auch in Corona-Zeiten eine wichtige Wirkung für den gesamten Staat, weil öffentliche Aufgaben dadurch von einem Dritten, einem NPO-Rechtsträger ausgeführt werden (z.B. Jugendhilfe, Gesundheit, Wissenschaft, Politik, Kunst und Kultur, u. A.), die jetzt alle, was Förderungen anbetrifft, sehr relevant werden nächsten Jahren.
Ökonomische Betrachtung
Wenn man final ökonomisch daran denkt, dass das neue Gesetz mit zahlreichen Satzungen der 23.000 Stiftungen bürgerlichen Rechts, die es in Deutschland gibt, abgeglichen werden muss und für manche Satzungsänderungen dann womöglich auch noch Behörden erforderlich sind, wird der bürokratische und beratungstechnische Aufwand für Stiftungen ersichtlich und dieser ist völlig überzogen.
Man kann nur hoffen, dass das Thema im noch nicht begonnenen Wahlkampf in Deutschland landet und möglicherweise erst in der neuen Regierungszeit der neuen Bundesregierung wieder auf den Prüfstand kommen. Man hört in der „Stiftungs-Szene“ dass die Kirchen ebenfalls nicht begeistert sind von den bisherigen Entwürfen.
Im Grunde ging es ja zunächst nur um ein etwaiges „Stiftungs- Register“, ähnlich wie ein Handelsregister, wobei auch hier die Frage gestellt werden muss, ob alle vertraulichen Daten und privaten Fragen hier unbedingt für den „Rechtsverkehr“ hinein gehören (Stifterschutz) und ob nicht auch ein juristisch härter ausgestaltetes berechtigtes Interesse – wie beim Grundbuchamt – für eine Einsicht in das Stiftungs-Register und abschreckende Kostenpauschale erforderlich ist, um hier Daten abzugreifen – und zwar nicht nur im nationalen Bereich, sondern auch im supranationalen Bereich, der dann ja auch „Zugriff“ hätte.
Die berechtigte Hoffnung an einem Einsehen des Gesetzgebers stirbt zuletzt. Schließlich muss das Bundes-Gesetz ja auch durch den Bundesrat, weshalb sich die Ministerpräsidenten, die ein Interesse haben müssten, in ihrem Bundesland jeweils viele Stiftungen für wichtige Gemeinwohlzwecke zu beheimateten, sich gut überlegen werden, ob sie ihre Machtfülle einfach so abgeben wollen und unnötiger Zentralisierung zustimmen.
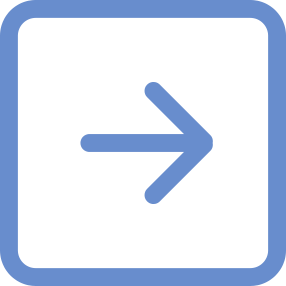
Rechtsanwalt Dr. Ferdinand Müller zeigt auf, wie anhand der derzeitigen Gesetzeslage einschließlich der Corona-Gesetze in Deutschland und in der Schweiz unterschiedlich auf den Einsatz von Videokonferenzen durch das Gericht reagiert werden kann.
Verwaist die Straßen, geschlossene Restaurants, leere Straßenbahnen und Züge: Alles stand still während des Shutdown. Wirklich alles? Die Gerichtsbarkeit sollte vom Grundsatz her nicht zum Stillstand gebracht werden, da nach der deutschen Zivilprozessordnung ein Stillstand der Rechtspflege im gerichtlichen Bereich Auswirkungen nach ZPO auf Fristenläufe hat.
In der Schweiz hat man bei der Corona-Gesetzgebung dagegen auch einen Fristenstillstand für die Gerichte zur Aufrechterhaltung der Justiz im Zusammenhang mit dem Corona- Virus (Covid- 19) beschlossen. Dort fanden offiziell vom 21. März 2020 bis zum 19. April 2020 keine Zivilprozesse statt. Eine Ausnahme gilt, wenn die Parteien des Rechtsstreits sich trotz des Fristen- Stillstandes einverstanden erklärten, eine Verhandlung durchzuführen.
Vor einem solchen Zivil-Gericht sollte gar dennoch eine mündliche Verhandlung mitten im Lockdown am 7. April 2020 stattfinden, weil zuvor eine Vergleichsverhandlung gescheitert war und eine Partei die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragt hatte. Eine Terminsfindung wurde vor Ausbruch der Pandemie mühsam für 7.4. bewerkstelligt.
Zwei Wochen vor der Verhandlung informierte die Richterin die Parteien darüber, dass die Verhandlung angesichts der Umstände im Rahmen einer Videokonferenz stattfinden werde. Die Parteien wurden angehalten, auf ihren Smartphones die App „Zoom Cloud Meetings“ zu installieren und an der Verhandlung von ihrem jeweiligen Standort aus teilzunehmen. Die Richterin begründete ihre Entscheidung mit der gravierenden Pandemie -Notlage, deren Ende nicht absehbar sei und betonte zentrale Bedeutung einer weiterhin funktionierenden Justiz. Sie stützte sich dabei auf das Richterrecht , richterliches Ermessen und Unabhängigkeit, und verwies auf die dortige Schweizer Zivilprozessordnung.
Der Gesetzgeber sei grundsätzlich „positiv“ gegenüber Videokonferenzen.
Eine Partei des Prozesses zeigte sich jedoch nicht einverstanden und machte bei dieser Verhandlung nicht mit und zog, nachdem sie online nicht teilnehmen wollte und eine Art von Versäumnisurteil erging, den Rechtsstreit weiter die nächste Instanz, die der Richterin mangels gesetzlicher Grundlage die Entscheidung zur Durchführung der Hauptverhandlung am 7. April 2020 als nicht zulässig zurückwies.
Es gibt somit in der Schweiz, die nicht der EU angehört, keine gesetzliche Grundlage für das Gericht, gegen den Willen der Parteien eine Videokonferenz anzuordnen. Also kann auch durch die außerordentliche Lage infolge der Corona -Virus -Pandemie nichts anderes gelten. Die Verhandlung vor dem Ausgangsgericht musste also wiederholt werden.
Wie wäre der Fall in Deutschland gelaufen? Auch hier sieht § 128a ZPO Möglichkeit vor, mit Videokonferenzen zu arbeiten. Dies mit Zustimmung der Parteien des Rechtsstreits, aber auch von Amts wegen. Bestimmte Tools sind nicht vorgeschrieben. Man sieht, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie die Gerichte vor große Herausforderungen stellen. Wenn man die Digitalisierung der Justiz vorantreiben möchte, muss aber eine gute und angemessene sowie wegen Art. 20, 19 IV GG verfassungsrechtlich haltbare gesetzliche Grundlage geschaffen werden.
Dabei gibt es in Deutschland aufgrund der zivilprozessualen Erfahrung mit Zeugenvernehmungen eben auch die Grundsätze des Unmittelbarkeitsgrundsatzes und des Mündlichkeitsgrundsatzes. Ferner muss überlegt werden im Rahmen der Beweisaufnahmen, wie es mit Zeugeneinvernahmen sich verhalten soll, wobei hier eine Differenzierung geschaffen werden müsste, ob es um ein Auslandszeugen geht oder um einen im Inland ansässigen Zeugen. Der Gesetzgeber hat in seiner Corona-Gesetzgebung die ZPO nicht abgeändert. Manche Schiedsverfahrensordnungen verweisen im Bezug auf Beweisaufnahmen auf die deutsche Zivilprozessordnung. Dies müsste ebenfalls beachtet werden, wenn Gesetze geändert werden.
In Deutschland ist die Entscheidung eines Gerichts, eine Videokonferenz durchzuführen, anstelle einer mündlichen Verhandlung, gemäß § 128a Abs. 3 S. 2 ZPO ebenso wenig anfechtbar, wie die Ablehnung eines entsprechenden Antrags (Ausschluss des Beschwerderechts von § 567 Abs. 1 Nr. 2 ZPO).
Im Interesse des Rechtsstaats sollte jedenfalls eine Regelung geschaffen werden, die eine einvernehmliche Regelung für eine Videokonferenz zwischen den Gericht und den Parteien voraussetzt und im Übrigen auch eine Anfechtbarkeit einer Ermessensentscheidung des Gerichts, ob sie eine Videokonferenz in Anbetracht einer konkreten Gefahrenlage von Amts wegen anordnet vorgesehen sein. Der Grundsatz ist immer noch der, dass Parteien über den Rechtsstreits mündlich verhandeln. Nach §128 Abs. 2 ZPO kann bei normalen Verfahren nur mit Zustimmung der Parteien ohne mündliche Verhandlung eine Entscheidung getroffen werden.
Ferner muss z.B. für das Steuerverfahrensrecht bedacht werden, dass auch hier in § 155 FGO auf die Zivilprozessordnung verwiesen wird, soweit nicht in Finanzgerichtsordnung andere Regelungen für die Verfahren vorgesehen sind.
Der Einsatz von Videotechnik im Zivilprozess begegnet ,soweit er die Anwesenheit der Parteien und der Parteivertreter (Prozessbevollmächtigten) ersetzt ,vom Grundsatz her in manchen Bereichen zwar keinen tiefergreifenden Bedenken (z.B. Güteverhandlung in der Arbeitsgerichtsbarkeit, einem ersten finanzgerichtlichen Erörterungstermin mit dem Einzelrichter), aber anders kann es bei Beweisaufnahmen sein. Dort ist eben der persönliche Eindruck und die persönliche Körpersprache von Bedeutung für die Prozessbeteiligten. Bei technischen Störungen liegt sicher ein Verstoß gegen das Mündlichkeitsprinzip vor. In diesen Fällen müsste eine Verhandlung sofort unterbrochen werden.
Bei Beweisaufnahmen in Bezug auf Zeugen ergibt die berechtigte Befürchtung einer Prozesspartei, dass der persönliche Eindruck, den das entscheidende Gericht von der Beweisperson bei der Videovernehmung gewinnt, eben nicht von gleicher Intensität und Qualität ist wie bei persönlicher Anwesenheit im Gerichtssaal, was im Grunde nicht bestritten werden kann. Besonders, wenn es auf die Glaubhaftigkeit von Beweisperson ankommt, sollte auch gesetzlich geregelt werden, dass dann das Gericht auf Antrag bzw. von Amts wegen auf einer Vernehmung im Gerichtssaal bestehen muss. Der Rechtsstaat ist massiv gefährdet, wenn sich herausstellt, dass die Unwahrheit leichter in eine Kamera gesagt ist als direkt in das Angesicht eines Richters, der vorher nach StGB und ZPO belehrt und links und rechts vom Zeugen auch noch Rechtsanwälte nahe beim Zeugen sitzen. Die Einbußen bezüglich des unmittelbaren Eindrucks vom Zeugen, Sachverständigen oder der anzuhörenden Partei im Sinne von §§ 2 78, 279 , 142 ff. ZPO sind ganz erheblich.
Anders kann es bei schwer zu erreichenden Auslandszeugen sein. Eine Partei im Zivilprozess ist manchmal froh, wenigstens auf diese Weise den Zeugenbeweis einführen zu können , wenn es den Zeugen nicht möglich ist, nach Deutschland zu kommen - aus verschiedenen Gründen - und im Zivilprozess (Beibringungsgrundsatz oder Verhandlungsgrundsatz) starke Beweis- und Darlegungslasten für eine Partei bestehen, d. h. wenn der Zeuge überhaupt nicht aussagt oder nicht zugeschaltet wird, eine ganze unbewiesene Tatsachen- Ausführung zu einem Sachverhalt in sich zusammenbrechen kann. Jedenfalls ist der Stand in Deutschland so, dass die Anordnung einer Videokonferenz durch den Richter erst im Rahmen eines Rechtsmittels (z. B. Berufung) gegen die Endentscheidung in erster Instanz überprüft werden kann. Da jedoch die Berufung in Deutschland nicht immer eine Tatsacheninstanz ist, eine Tatsacheninstanz ggfs. auch dann verloren geht, wenn die II. Instanz selbst Beweise erhebt (z. B. nach § 527 II 2 ZPO, § 529 Nr.1 ZPO, dieses Mal jedoch unmittelbar im Gerichtssaal) ist das in jedenfalls auch rechtstaatlich zu wenig und gesetzgeberisch zu ändern.
Auch die im Abänderungsrecht zum 1. November 2013 zum ZPO-Reformgesetz verworfene Pflicht der Gerichte zur Aufzeichnung der Video-Vernehmung auf Tonträgern, wäre bei einer Reform zu überdenken. Ferner ist sicherzustellen, dass Vorschriften über die Protokollierung und Rechte dazu (§§ 160 -164 ZPO, u.a.) ausdrücklich auch für Videokonferenzen im Zivilprozess immer einzuhalten sind. Erst durch die Erfahrungen der Gerichte und Parteien mit Videokonferenzen wird sich zeigen, ob die Videokonferenz der Gerichtsverhandlung vorzuziehen ist oder nur deren Ergänzung in Ausnahmesituationen darstellt.
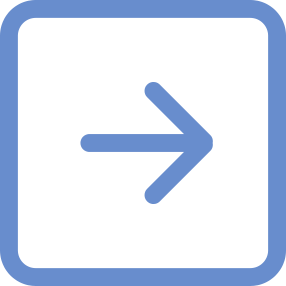
Führt Home-Office gar zur steuerlichen Betriebsstätte?
Dr. Ferdinand Müller skizziert, welche Risiken und welcher Anpassungsbedarf aus einem verlängerten Homeoffice entstehen können.
Die Frage der Betriebsstättenbegründung in fremden Räumlichkeiten umfasst auch die Fragestellung, ob das Home-Office und damit die Privatwohnung eines Arbeitnehmers Betriebsstätte eines Unternehmens sein kann oder ob keine ausreichende Verfügungsmacht über diese „fremden Räumlichkeiten“ besteht. Diese Fragestellung tritt häufig mit der Frage der Begründung einer Vertreterbetriebsstätte auf, wenn diese Betriebsstätte zB abkommensrechtlich mangels Abschlussvollmacht oder mangels Vertretereigenschaft eines Organs der Gesellschaft abgelehnt wird.
Eine Betriebsstätte ist nach deutschen Abgabenrecht jede feste Geschäftseinrichtung oder Anlage, die der Tätigkeit eines Unternehmens dient, wobei auch die Kriterien Ortsbezogenheit, Nachhaltigkeit und Verfügungsmacht eine weitere Konkretisierung dafür geben. Der Unternehmer muss jedenfalls eine gewisse Verfügungsmacht darüber haben.
Diese Frage kann jedoch auch dann auftreten, wenn festgestellt wird, dass die Geschäftsleitung an eine bestimmte Person gekoppelt ist, die überwiegend oder vollständig von ihrem Home-Office aus arbeitet, und damit die Privatwohnung als Ort der Leitung des Unternehmens anzusehen ist.
Die OECD hat diese Problemstellung auch im Diskussionsentwurf 2013 zur Zuordnung von Gewinnen zu Betriebsstätten aufgegriffen und schlägt eine Ergänzung vor. Demnach soll die Ausübung der Unternehmenstätigkeit in den Räumlichkeiten eines Arbeitnehmers nicht zwangsläufig zur Ablehnung einer Betriebsstätte führen; vielmehr soll eine Abwägung im Einzelfall vorgenommen werden. International gibt es den Trend, die Anforderungen an eine Betriebsstätte zu senken. In Österreich ist man der Auffassung, eine Betriebsstätte liege bereits dann vor, wenn der Arbeitnehmer in Abstimmung mit dem Arbeitgeber seine Tätigkeit in nennenswertem Ausmaß, das bedeutet rund 25 % der Gesamtarbeitszeit, von seinem Home-Office nachgehe.
Nach Ansicht der anderen Stimmen sind ohnehin viele Fälle, in denen Arbeitnehmer von zu Hause arbeiten, nur von zeitweiser oder gelegentlicher Art, so dass keine Verfügungsmacht des Arbeitgebers anzunehmen sein soll.
Jedoch soll in solchen Fällen, in denen das Home-Office regelmäßig oder sogar durchgehend genutzt wird und es sich ausgehend vom Sachverhalt eindeutig feststellen lässt, dass das Unternehmen dem Arbeitnehmer vorgibt, das Home-Office zu nutzen, auch das Home-Office eine Betriebsstätte des Unternehmens begründen können.
So soll der Fall auch liegen, wenn das Unternehmen dem Arbeitnehmer kein Büro zur Verfügung stellt, obwohl sich aus dem Charakter des Beschäftigungsverhältnisses eigentlich die Notwendigkeit eines Büros ergibt.
Sollten diese Änderungen tatsächlich im nächsten Update des OECD-MK nochmals aufgegriffen und umgesetzt werden, dürften sich daraus erhebliche praktische Probleme ergeben. Dies scheint die Gesetzgebung selbst auch zu sehen und nimmt bereits vorsorglich eine Einschränkung mit in den Entwurf zur Tz. 4.9 des Musterkommentars dahingehend auf, dass in den meisten Fällen, in denen sich die Frage der Betriebsstättenbegründung stellt, ohnehin das Unternehmen eine feste Geschäftseinrichtung im selben Staat unterhalte, „an die der Arbeitnehmer berichte“.
Außerdem seien die im Home-Office ausgeübten Tätigkeiten überwiegend lediglich vorbereitender Art oder Hilfstätigkeiten und damit greife ohnehin der Ausschlusstatbestand des Art. 5 Abs. 4 Buchst. e OECD-MA ein.
Diese Einschränkungen der OECD können keinesfalls überzeugen. Insbesondere in Zeiten günstiger Flugverbindungen und der umfassenden Möglichkeiten des Zugriffes auf Firmennetzwerke durch gesicherte VPN-Verbindungen besteht die Gefahr der grenzüberschreitenden Home-Office-Betriebsstätte nicht nur für den klassischen Grenzpendler. Auch der Hinweis auf Art. 5 Abs. 4 OECD-MA geht fehl und ist nicht überzeugend.
Viele wertschöpfende Bürotätigkeiten lassen sich nahezu ohne jegliche Einschränkung auch über ein Home-Office erledigen, soweit dort eine gewisse Organisationsstruktur sichergestellt ist.
Es trifft jedoch zu, dass in vielen Fällen das Home-Office lediglich eine Ergänzung des normalen Arbeitsplatzes ist. Selbst wenn der Arbeitnehmer in diesen Fällen den Hauptteil seiner Tätigkeit nicht im Büro, sondern von seinem Home-Office aus durchführt, verbleibt es auch nach den möglichen Ergänzungen des Musterkommentares bei dem Ergebnis, dass das Unternehmen keine Betriebsstätte begründet. Unternehmen, die nach dem ersten Lockdown Mitarbeiter in erheblichen Umfang weiterhin im Home-Office arbeiten lassen wollen, um langfristig Mietkosten zu sparen, müssen vorsichtig agieren. Gerade bei internationalen Unternehmen ist es notwendig, die Steuerrisiken der geplanten Home-Office-Konzepts vorrangig zu analysieren. Ansonsten besteht das Risiko, dass die angestrebten Kosteneinsparungen durch unerwartete Steuerrechnungen und erhebliche Verfahrenskosten eliminiert werden.
Zu prüfen ist in jedem Fall in diesen Fallkonstellationen auch, ob der Home-Office -Mitarbeiter nicht ggf. eine Vertreterbetriebsstätte begründet.
In einem in Corona-Zeiten denkbaren Fall, dass bei einer GmbH die beiden Gesellschaftergeschäftsführer sowie drei Prokuristen allesamt in einer Ortschaft, die nicht dem tatsächlichen Verwaltungssitz der GmbH entspricht, zeitgleich ins Home-Office gehen, muss ferner die Diskussion aufgeworfen werden, welche Konsequenzen dies für die GmbH und die Geschäftsführer in punkto Handelsregister, etc. bereits im Inland haben kann. Dies für den Fall, dass z. B. dass nach einem Lockdown das Home-Office ein Zeitraum von mindestens 6 bis 12 Monate fortgesetzt wird.
Selbstverständlich spielt die Zeitdauer dieser Home-Office-Abwesenheit der Gesellschaftergeschäftsführer die maßgebliche und wesentliche Rolle.
Gesellschaftsrechtlich ist dabei sicher Folgendes von Bedeutung:
Der Sitz der Gesellschaft muss in der Satzung angegeben sein. Die Festlegung des Sitzes unterliegt der freien Entscheidung der Gesellschafter. In der Regel befindet sich der Sitz dort, wo sich die Geschäftsleitung oder die Verwaltung befindet. Nach der Rechtsprechung des EuGH („Überseering“, EuGH 5.11.2002 – C-208/00, NJW 2002, 3614) bleibt die Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bei einer Sitzverlegung in einen EU/EWR-Staat erhalten. § 4a Abs. 2 GmbHG a. F. stand dem Auseinanderfallen von Verwaltungs- und Satzungssitz allerdings entgegen.
Durch die Streichung des § 4a Abs. 2 GmbHG durch das MoMiG ist es deutschen Gesellschaften nun möglich, einen Verwaltungssitz zu wählen, der nicht mit dem Satzungssitz identisch ist.
Dieser Verwaltungssitz kann auch im Ausland liegen. Zum Schutz inländischer Gläubiger muss in diesen Fällen auch eine inländische Geschäftsanschrift zur Eintragung ins Handelsregister angegeben werden. Unter dieser Anschrift können alle Zustellungen erfolgen, wobei eine unwiderlegbare Vermutung begründet wird, dass der Geschäftsführer unter der eingetragenen Adresse erreicht werden kann. Damit können inländische Konzerne ihre Auslandstöchter auch in der Rechtsform einer GmbH führen.
Abschließend bleibt zu untersuchen, ob bei einem dauerhaften Auseinanderfallen von Satzungs- und Verwaltungssitz der Verwaltungssitz gar eine Haupt- oder Zweigniederlassung nach HGB und GmbHG ist.
Nach neuem Recht ist es möglich, dass am Satzungssitz nur ein Briefkasten existiert und sich die Geschäftstätigkeit von einem Verwaltungssitz entfaltet, der an einem anderen Ort liegt.
Mag dieser Ort dann zwar rein faktisch eine Hauptniederlassung sein (Otte, in: BB 2009, S. 344, 345), so ändert dies nichts daran, dass das Gesetz bei Handelsgesellschaften den Begriff der Hauptniederlassung nicht verwendet und stattdessen auf den Sitz der Gesellschaft abhebt.
- 13 HGB bestimmt, dass die Registerzuständigkeit für sämtliche Niederlassungen am Ort des Sitzes der Gesellschaft konzentriert wird, so dass dann, wenn der Satzungssitz von dem Ort des Verwaltungssitzes abweicht, der Satzungssitz entscheidend sein muss (Pentz, in: Ebenroth/Boujong.u.a., HGB, § 13 Rn. 20, 26).
Dies hat zur Folge, dass für den Ort des tatsächlichen Verwaltungssitzes eine Zweigniederlassung beim Register des Satzungssitzes nach § 13 Abs. 1 HGB bei gewisser Dauer anzumelden ist, die dort gemäß § 13 Absatz 2 HGB eingetragen wird (Wicke, GmbHG, 2008, § 4a Rn. 7; Heckschen, DStR, 2009 , 168 ff.) und nur die Verlegung des Satzungssitzes ein Anwendungsfall des § 13 h HGB ist.
Es bleib abzuwarten, was durch die zweite Corona-Welle hier noch auf allen Ebenen passiert und durch die Ankündigung der US- Tech-Konzerne, u.a. Google, Mitarbeiter gar bis 30.06.2021 in Home-Office arbeiten zu lassen.
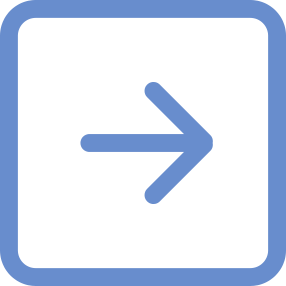
Dr. Sven Claussen skizziert im Folgenden einen Überblick über die Auswirkungen der zweiten Aktionärsrechterichtlinie auf Vorstandsvergütung und Related Party Transactions.
Das ARUG II belässt es bei der Festlegung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder beim Aufsichtsrat mit einem hohen Ermessensspielraum. Hinzu kommt jedoch ein unverbindliches Votum der Hauptversammlung zum vorgelegten Vergütungssystem. Der Aufsichtsrat ist jedoch künftig nach § 87a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AktG-E verpflichtet, eine Maximalvergütung für die Vorstandsvergütung festzulegen, welches jedoch bereits verbreitete Praxis war und den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex entsprach.
Die Hauptversammlung kann jedoch nach § 87 Abs. 4 AktG-E zukünftig die vom Aufsichtsrat festgelegte Maximalvergütung für den Vorstand durch verbindliches Votum reduzieren, falls eine Ergänzung der Tagesordnung mit Mindestquorum von 5 % oder einen anteiligen Betrag von EUR 500.000 des Grundkapitals beantragt worden ist.
Im Vergütungsbericht müssen Vorstand und Aufsichtsrat zu jedem einzelnen namentlich genannten Vorstandsmitglied erläutern, wie die festgelegte Maximalvergütung eingehalten wurde (§ 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 AktG-E).
Der Schwellenwert für Geschäfte mit nahestehenden Personen (Related Party Transactions, RPT) auf 1,5 Prozent der Summe aus Anlage- und Umlaufvermögen auf der Basis des zuletzt festgestellten Jahresabschlusses bzw. gebilligten Konzernabschlusses herabgesetzt (§ 111b Abs. 1, 3 AktG-E). Aktuell beträgt der Schwellenwert 2,5 %.